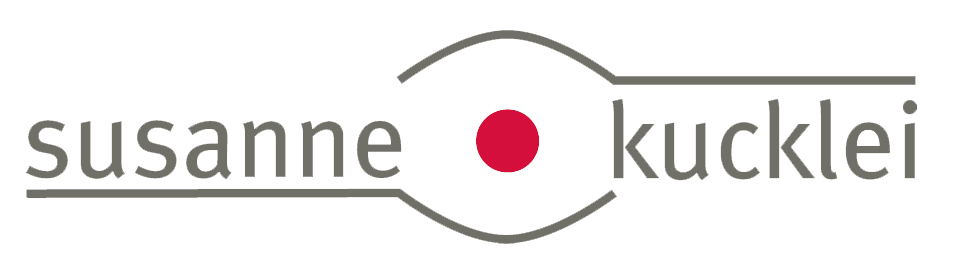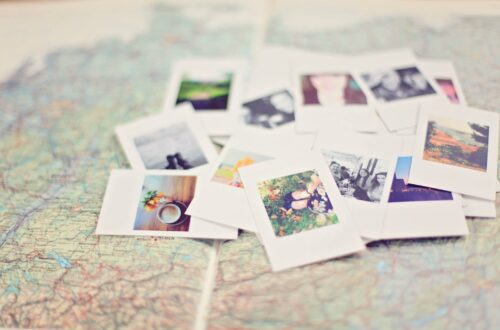Was uns prägt und bindet
Glaubenssätze, Aufträge und Loyalität aus der Ursprungsfamilie bestimmen unser Leben und können eigene Entwicklungen verhindern
Mit Begeisterung habe ich das unlängst erschienene Buch von Sandra Konrad „Das bleibt in der Familie“ gelesen. Darin sind wesentliche Erkenntnisse darüber benannt, welche Macht familiäre Aufträge, Loyalität und Wiederholungen aus dem ursprünglichen Familienband über das Leben in der Gegenwart haben. Das deckt sich in vielerlei Hinsicht mit meinen Erfahrungen in meiner Beratungspraxis. Die wichtigsten Einsichten daraus bieten gute Anhaltspunkte zum Nachdenken – vielleicht und gerade in der Lebensmitte, meinem Spezialthema. In der Lebensmitte wird uns die Endlichkeit des Lebens bewusst und damit auch nicht gelebte Lebensanteile klarer – wenn wir darauf schauen!
Wünsche und Aufträge aus dem Familienclan
Familiäre Aufträge beginnen teilweise schon vor der Geburt eines Menschen. Angefangen mit dem Wunschgeschlecht, das am besten in eine Familie oder zu einem passt. Ich selbst war nicht frei davon. Hatte ich mir doch mit dem Wissen, dass ich ein Kind erwarte, damals ein Mädchen gewünscht. Vielleicht auch aus dem Grund, noch mal ein anderes (zweites/neues) Leben mit meiner Tochter zu (er-)leben. Dies geschieht natürlich in großen Teilen unbewusst. Welches Schicksal ereilt aber all diejenigen, die nicht das Wunschgeschlecht ihrer Eltern tragen? Töchter, die dann wie Söhne heranwachsen oder auch andersrum. Denn eins ist klar, durch die bedingungslose Liebe und Abhängigkeit, werden sich die Kinder so verhalten, wie es sich die Eltern wünschen.
Namensgebung als Auftrag
Auch die Namensnennung kann schon vielerlei Aufträge beinhalten. Vielleicht trägt man den Namen der geliebten (verstorbenen) Großmutter, eines zuvor verstorbenen Kindes oder aber einer Ideologie, die mit dem Namen verbunden ist. Früher war es „Maria“ oder vielleicht „Adolf“, heute könnte es eine „Helene“ oder ein „Justin“ sein, die durch den Vornamen schon einen Auftrag bekommen, ähnlich erfolgreich wie der Namenspate zu werden.
Rollen in Familiensystemen
Oftmals werden den Erstgeborenen besondere Rollen zugeschrieben. Vor allem dann, wenn die Eltern schwach sind, tragen Erstgeborene in ihrem Leben immer wieder zu viel Verantwortung – schon von Kindesbeinen an. Diese Rolle kann dann wie eine „Zwangsjacke“ das weitere Leben bestimmen. Parentifizierung, so heißt das Fachwort dafür. Gemeint ist die Übernahme der Elternrolle oder manchmal sogar der Partnerrolle durch die Kinder, um das fragile Familiensystem am Leben zu erhalten. Diese Rollen werden häufig von Kindern übernommen, wenn Eltern durch Sucht und Depressionen ihre Aufgabe nur unzulänglich wahrnehmen können. Selbst in der Pubertät gelingt es oft nicht, aus dieser Rolle herauszukommen und die normale Rebellion bzw. Ablösung dieser Phase zu erleben, denn das Familiensystem braucht einen.
Wenn dann noch jüngere Geschwister von einem abhängig sind, ist die Ablösung hin zu einem eigenen Leben umso schwieriger. Blicke ich auf meine eigene Lebensgeschichte zurück, dann fiel die Scheidung meiner Eltern genau in meine Pubertät. Auch ich konnte damals wenig pubertierendes Verhalten an den Tag legen, da es in unserem Familiensystem dafür keinen Raum gab. Bewusst geworden ist mir das allerdings erst sehr viel später – damals habe ich funktioniert.
Opfer des Familiensystems
Das Kind als Retter der Familie – diese „Retterrolle“ kann einen dann dauerhaft verfolgen. Etwas oder jemanden zu retten, ist eine Aufgabe, die man im Leben immer finden kann, aber die eigenen Bedürfnisse kennt man nicht. Uwe Böschemeyer beschreibt dies so treffend: „Die Schwachstelle [des Retters] ist die Selbstferne.“ Die eigenen Grenzen zu kennen und die eigenen Bedürfnisse zu formulieren, fällt Menschen, die diese Rolle von früh auf gelernt haben, sehr schwer, denn es ging ja immer darum, die Bedürftigen in der Familie zu versorgen – nie sich selbst. Ein weiteres Problem dabei ist, dass dies zur Prägung von Bindungserfahrungen führt, die dann – wenn sie nicht erkannt werden – in der Folgegeneration in Form von emotionaler Unterversorgung und Rollenumkehr erneut an die eigenen Kinder weitergegeben werden.
Welchen Auftrag erhält man im Familiensystem?
Ausgesprochene und unausgesprochene Aufträge aus der Ursprungsfamilie haben ebenfalls einen gravierenden Einfluss auf das eigene Leben. Sie führen im schlimmsten Falle dazu, dass kein eigenes Selbst gebildet wird und die Ablösung von der Familie nicht erfolgen kann. Sei es durch klar vorgegebene Berufsvorgaben an die Kinder (wie etwa: „Du wirst mal Ärztin“), obwohl die Kinder möglicherweise ganz andere Begabungen oder Interessen in sich tragen. Oder Familienkonstellationen, wo es z.B. darum geht, den eigenen Eltern möglichst viele Nachkommen zu bescheren oder der vorgegebenen Rollenverteilung zu entsprechen. Auch Homosexualität kann nicht ausgelebt werden und man gaukelt jahrzehntelang eine „normale“ Familie vor, obwohl alle Familienmitglieder ein nicht ausgesprochenes Geheimnis spüren und unglücklich sind. Dieses Phänomen habe ich schon mehrfach in meinen Beratungen erfahren können.
Können Kinder dies gut und gerne erfüllen, weil es ihnen entspricht, dann ist ein positiver Grundstein gelegt, so formuliert es Sandra Konrad. Falls diese Erwartungen jedoch nicht dem Wesen der Kinder entsprechen, werden sie leicht Opfer von unerfüllbaren Aufträgen, die verhindern, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen und eigene Ziele anzustreben.
Noch gravierender ist dies, wenn die Ablösung so stark verhindert wird, dass Kinder ihre Eltern – auch räumlich – nicht verlassen dürfen. Konrad betitelt dies mit „Bis das der Tod uns scheidet“ und beschreibt Erwachsene, die keine eigene Familie gründen können oder dürfen, weil sie durch ein ungesundes Elternsystem lebenslang an die Ursprungsfamilie gebunden sind.
Kinder die im Familiensystem stören
Im Gegensatz zu den klammernden Eltern steht das „Pippi Langstrumpf-Symptom“ oder das „Gregor Samsa Symptom“ aus Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“. Früh erwachsen werden, wie Pippi Langstrumpf als sympathische Heldin, deren Stärke und Unabhängigkeit allerdings zur Kompensation von kindlicher Ohnmacht dient: Ich brauche niemanden und mache mir die Welt, wie sie mir gefällt! Ein deutlich negativeres Beispiel ist Gregor Samsa, der durch die Verwandlung in einen gepanzerten Käfer die Lieblosigkeit der Familie nicht mehr spürt und schließlich ganz verschwindet, da er keine Daseinsberechtigung mehr hat.
Diese beiden Protagonisten dienen als Beispiel für Kinder, die nur geduldet werden, manchmal materiell (über)-versorgt, aber immer emotional unterversorgt sind. Es sind die Kinder, die gleich erwachsen sein sollen, damit sie die Eltern nicht stören oder behindern.
Bei beiden Ausrichtungen, der klammernden oder vernachlässigenden Form, handelt es sich letztlich um ausgebeutete Kinder. Daraus entwickeln sich Erwachsene, die Zeit ihres Lebens – wenn dies nicht therapiert wird – eine Sucht nach Liebe, Anerkennung und Gesehen werden entwickeln. Hier braucht es gute Beziehungserfahrungen in der Gegenwart, um diese Wunden zu heilen.
Loyalität – ein unkündbarer Familienvertrag
Loyalität ist die innere Verbundenheit zu den Eltern. Loyalität entsteht durch die Bindung an das Familiensystem, um dazu zu gehören und Liebe und Anerkennung zu bekommen. Wer ist man schon alleine – besonders als Kind? Menschen brauchen Zugehörigkeit, wie die Luft zum Atmen. Wenn diese Loyalität allerdings unbewusst ist, sozusagen unsichtbar, können dadurch eigene Entwicklungsschritte verhindert werden, nur weil man wiederum das Familiensystem schützen will. Dies verhindert dann ein „Mein Leben gehört mir“ und führt im schlimmsten Fall dazu, dass Kinder das ungelebte Leben der Eltern führen oder dies – unbewusst – fortsetzen. Auch wenn sie bewusst, aber als Trotzreaktion, ein ganz anderes Leben als die Eltern führen, findet keine reife Ablösung statt.
Interessant werden diese Loyalitäten auch, wenn zwei Familiensysteme durch Eheschließung oder Familiengründung zusammen kommen. Welchen Namen trägt z.B. die neu gegründete Familie? Ich kann mich noch gut an die Diskussionen dazu bei meiner Eheschließung erinnern. Meinen Nachnamen, den ich von Geburt an hatte, wollte ich auch bei der Familiengründung nicht abgeben.
Auch Traditionen und Rituale aus der Ursprungsfamilie haben Einfluss auf neu gegründete Familiensysteme und können sogar zerstörerisch wirken, weil sie letztlich kein neues Familiensystem zulassen. Gestörte Loyalität, so führt es die Autorin auf, ist, wenn Eltern ihre Kinder ausbeuten, ihre Grenzen verletzen (Missbrauch) oder den totalen Gehorsam erwarten. Loyalität ist wie ein Klebstoff, den man – wenn es sich um kranke Familiensysteme handelt – schwer lösen kann. Gerade in Familien, die auf alte Traditionen aufbauen oder Unternehmerfamilien, ist eine Ablösung hin zu einem selbstbestimmten Leben sehr schwer.
Traumatisches Erbe
In ihrem vorletzten Kapitel beschäftigt sich Konrad mit den Auswirkungen von Traumata aus den vorangegangenen Generationen (transgenerationale Weitergabe). Die Erfahrungen der Kriegsgenerationen wirken bis auf die Generation der Kriegsenkel ein, auch wenn diese den Krieg gar nicht erlebt haben. Das ist wiederum ein Hinweis darauf, wie stark wir mit unseren Wurzeln verbunden sind und wie diese unser aktuelles Gefühlsleben bestimmen, auch wenn wir die Erfahrungen nicht persönlich erlebt haben. Ich selbst fühlte mich – unbewusst – mit dem Schicksal meiner Tante verbunden. Meine Großeltern hatten aufgrund der Vertreibung aus dem heutigen Polen ihre Tochter auf der Flucht verloren. Jahrzehntelang hat sie mein Leben geprägt, da ich als Ersatztochter für meine Großeltern diente. Erst durch eine Familienaufstellung wurde mir die Verbindung zu meiner verstorbenen Tante bewusst und ich konnte ihr Schicksal an sie zurückgeben.
Was hilft für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben?
Welche Familiengeschichte auch immer die Ihre ist, es lohnt sich auf jeden Fall diese zu erforschen und zu hinterfragen. Konrad hat im letzten Kapitel ihres gut und leicht lesbaren Buches eine Reihe von guten Reflexionsfragen zusammengestellt, die hierzu eine Hilfestellung bieten. Diese Fragen dienen dazu, einen Gesamtüberblick zu erhalten, um das, was einen prägt oder auch bindet, klarer zu erkennen: Brüche im Leben, wichtige Daten, die Geschichte der Eltern und Großeltern, Bindungserfahrungen, verbunden mit prägenden Kriegserfahrungen und Beziehungserfahrungen aus der Ursprungsfamilie, Werte oder auch Konflikte sowie Traumata. Wem sind Sie ähnlich, wem fühlen sich verbunden? All dies hilft, die eigene Familiengeschichte wie ein Puzzle zusammenzusetzen und die Geschichte erneut zu schreiben. Wichtig ist es auch, die eigene Geschichte anzunehmen, nicht zu leugnen, denn dann wirken Teile daraus umso stärker. Und sicher entdecken Sie auch Ressourcen und Bewältigungsstrategien in Ihrem Familiensystem, die Ihnen für Ihr weiteres Leben wichtige Wegbereiter sein können.
Für mich und meine Klienten ist es auf jeden Fall hilfreich, sich mit dem System, aus dem man stammt, auseinanderzusetzen, um zu überprüfen, was davon übernehme ich gerne und was ist nicht hilfreich für meine eigene Entwicklung. Schon allein deswegen, um sich selbst zu verstehen und daraus zu lernen. Zu lernen, welchen Weg ich nun ab meiner Lebensmitte – selbstbestimmt und bewusst – weiter gehen möchte!

Zum Weiterlesen:
Sandra Konrad: Das bleibt in der Familie. Von Liebe Loyalität und uralten Lasten. September 2014. ISBN 978-3-492-30530-3, € 9,99 im Piper Verlag erschienen